von Emma Jacobs
„Alleine können wir so wenig tun;
zusammen können wir so viel tun.“
Helen Keller zit. nach Nguyen 2019
Gruppenarbeiten und Diskussionsphasen sind ein fester Bestandteil des Studiums. Dennoch sind sie für mich und auch für viele andere eher zum notwendigen Übel geworden. Letztes Semester habe ich zum Beispiel ein Seminar belegt, das einen großen Praxisanteil beinhaltete. Ich war zunächst total davon begeistert und startete mit großer Euphorie in das Semester. Im Seminar wurden uns in kleinen Grüppchen verschiedene Orts- und Themenbereich rund um das Thema „Uni“ und „Studium“ zugeteilt. Ein Großteil der Arbeit bestand dann darin Fotos einzuscannen und passende Informationstexte über den jeweiligen Ort zu verfassen. Da ich so gut wie niemanden kannte, schloss ich mich irgendeiner anderen Person an. Zunächst hat auch alles ganz gut geklappt, bis die Person Mitten im Semester ihr Studium abbrach und mir das erst Wochen später nach wiederholter Nachfrage mitteilte. Ich stand nun alleine mit einem großen Berg voller Arbeit da. Die Dozenten haben zwar versucht, mich einer anderen Gruppe zuzuordnen, aber am Ende hat mich keine Gruppe voll und ganz aufgenommen und ich wurde eher als eine zusätzliche Last angesehen. Obwohl wir alle an demselben Projekt gearbeitet haben und unsere Arbeit auch fundamental voneinander abhing, verlor ich jeglichen Anschluss an die Gruppe und war alleine auf mich gestellt. Ich musste am Ende das Seminar abbrechen, da ich die große Belastung nicht mehr aushalten konnte. Für mich war die Gruppenarbeit total gescheitert. In dem genannten Seminar war die Zusammenarbeit entscheidend für den Ausgang des Projektes. Dennoch gab es keine gute Gruppendynamik und es haben sich am Ende nur viele kleine Einzelgrüppchen formiert, die untereinander so gut wie keinen Austausch hatten. Das Projekt erzielte nicht den gewünschten Fortschritt und es sind viele Fehler geschehen, die man verhindern hätte können. Dieses Beispiel ist definitiv kein Einzelfall und so wie mir ist es schon vielen anderen Studierenden ergangen.
Doch was macht Gruppenarbeiten und Diskussionsphasen am Ende besser und erfolgreicher? Der stetige Austausch mit anderen scheint eines der zentralen und fundamentalen Inhalte von Zusammenarbeit im Studium zu sein. Man kann schlecht die ganze Zeit nur mit sich alleine diskutieren und man selbst kann auch nur bedingt viel Arbeit erledigen. Gerade in den Geisteswissenschaften sind andere Perspektiven oft wichtig, um gute Lösungen oder Antworten zu finden. Erst die Zusammenarbeit in der Gruppe ermöglicht es, größere Projekte in die Wirklichkeit umsetzen. Kommunikation spielt hierbei eine maßgebliche Rolle: Ohne Kommunikation funktionieren keine Gruppenarbeiten oder Diskussionsphasen. Dabei ist Kommunikation etwas, das stetig an den Kommunikationspartner angepasst wird. Man redet mit seinen Freund*innen auf eine andere Art und Weise als zu komplett fremden Menschen. Der Freund*innenkreis bietet oftmals einen „safe-space“, in dem man manchmal leichter und offener über emotionale Befindlichkeiten sprechen kann. Zur selben Zeit kann es aber auch schwerer sein, Kritik anzusprechen, aus Angst man könnte das Gegenüber dadurch verletzten. Im Gespräch mit unbeteiligten Fremden ist es manchmal leichter sich zu öffnen. Häufig ist es aber dennoch der Fall, dass die meisten Menschen bei fremden Personen zunächst etwas zurückhaltender in der direkten Kommunikation sind. Gerade im Studium trifft man in jeder Vorlesung, Gruppenarbeit oder Seminar auf neue unbekannte Menschen. Häufig ist die Zeit dabei zu kurz, um Einzelne genauer kennenzulernen. Darunter leidet die Kommunikation untereinander und somit auch die Zusammenarbeit in den Seminaren und Gruppenarbeiten. In meinem Beispiel hat das dazu geführt, dass sich mein Gruppenpartner erst viel zu spät bei mir gemeldet hatte. Ich hatte bereits über mehrere Wochen Nachrichten an die Person geschickt, aber erst sehr spät die Antwort über den Studienabbruch erhalten. Die meisten anderen Gruppen waren weit vorangeschritten und viele der Mitglieder waren schon vorher miteinander befreundet. Es war an diesem Zeitpunkt bereits sehr schwer, einen weiteren Anschluss zu finden. Mit einer besseren Kommunikation und Gruppendynamik, hätte man diesem folgenschweren Missverständnis vorbeugen können.
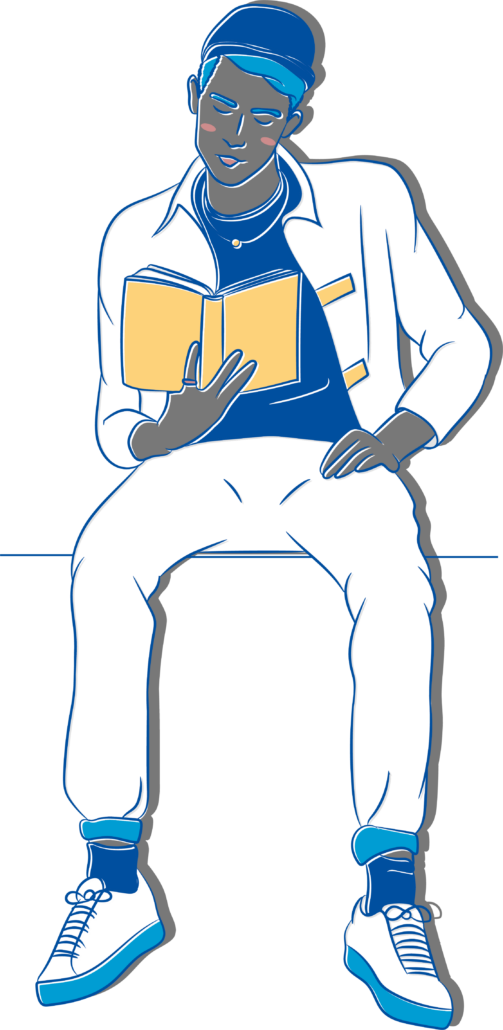
Mein oben genanntes Beispiel stammt aus einem Geschichtsseminar und leider bin ich solchen Situationen schon häufiger in meinem Geschichtsstudium begegnet. In den Geschichtswissenschaften wird ein großer Fokus auf Zusammenarbeit und Diskussionen gelegt: Sie sind ein zentraler Teil des Geschichtsstudiums. In jedem Seminar gibt es Gruppenarbeitsphasen und Gruppenreferate zu Forschungstexten oder historischen Quellen. Zu den meisten Texten werden im Plenum gemeinsam Fragen bearbeitet und Lösungen zu Forschungsproblematiken gefunden. Durch diesen stetigen Austausch sollen unter anderem verschiedene Meinungen und Perspektiven hervorkommen und dazu beitragen, ein möglichst vielfältiges Bild zu geben. Darüber hinaus sollen Gruppenarbeiten den Zusammenhalt im Studium positiv fördern. Dennoch sieht die Realität, wie oben bereits gezeigt, häufig anders aus. In den Seminaren beteiligen sich stets die gleichen Studierenden. Viele der Seminarteilnehmenden äußern sich während des Seminars nur selten bis gar nicht. Auch Gruppenreferate werden häufig eher zur Last, als dass sie sie einen voranbringen und weiterhelfen. Es kommt immer wieder zu Kommunikationsschwierigkeiten innerhalb der Gruppe, Fristen werden nicht eingehalten und die Arbeit mitunter ungerecht aufgeteilt. Manchmal gehen die Vorstellungen und Erwartungen innerhalb der Gruppe zu weit auseinander. Einige Gruppenteilnehmer wollen das Referat zum Beispiel schon mehrere Tage im Voraus fertig gestellt haben – für andere Mitglieder ist der Abend vorher als Frist ausreichend. Welcher selbstgewählter Zeitpunkt zum Beispiel für die Fertigstellung am Ende besser ist, bleibt eine offene Frage. Es geht vielmehr um das Prinzip, dass viele Gruppenarbeiten nicht dazu in der Lage sind ihre individuellen Vorstellungen und Erwartungen zu kommunizieren und aneinander anzupassen. Dieses Problem erklärt zum Teil auch das Verhalten von Studierenden in Seminaren. Einige von ihnen wollen möglichst viel aus dem Seminar herausholen und lesen dementsprechend zum Beispiel die gesamte Literatur und beteiligen sich aktiv. Für andere hingegen reicht es vollkommen aus, einfach das Seminar zu bestehen. Hinzu gibt es Studierende, die sich auch um Angehörige sowie eigene Kinder kümmern müssen oder mehrere Jobs zur Studienfinanzierung haben. Obwohl sie genauso ein aktiver Teil von dem Seminar sein wollen, ist es für sie häufig um einiges schwieriger. Es ist wichtig für eine gute Zusammenarbeit, diese verschiedenen Perspektiven und Motivationen immer wieder aufs Neue aneinander anzupassen und abzufragen. Zwar gibt es in den meisten Seminaren eine kurze Vorstellungsrunde am Anfang des Semesters, dennoch gibt diese häufig wenig Auskunft über die Motive und Interessen am Seminar. Am bedeutendsten ist, dass hierbei selten die Entwicklungen während des Seminars betrachtet werden. Welche Interessen haben sich vielleicht dazu entwickelt? Haben die Studierenden im Laufe des Semesters die Begeisterung für das Thema verloren? Welche Gründe gibt es dafür? Fühlen sich die Studierenden wohl im Seminar? Trauen sie sich offen zu beteiligen oder sind sie mit den Inhalten eventuell überfordert? Viele Dozierende stellen sich diese Fragen wahrscheinlich häufig im Bezug zu ihren Seminaren. Dennoch werden diese zumeist so gut wie gar nicht beantwortet. Zwar gibt es am Ende jedes Semesters „Feedback-Fragebögen“, diese stellen jedoch meist nur sehr oberflächliche Fragen. Meiner Erfahrung nach wird nur sehr selten wirklich versucht, Anpassungen während der Vorlesungszeit vorzunehmen. Der Kontakt zwischen Dozierenden und Studierenden bleibt in den meisten Fällen sehr formell und distanziert. Feedback zu geben, fällt auf diese Art und Weise sehr schwer.
Die Gruppenarbeiten leiden auch unter den distanzierten Umgang miteinander. Die Referatsgruppe kennt sich häufig nicht und auch während Bearbeitungsphase werden meistens keine Versuche unternommen, einander kennenzulernen. Somit existiert kein richtiger Gruppenzusammenhang und die Mitglieder fühlen sich der Gruppe weniger verpflichtet. Das führt meiner Erfahrung nach wiederrum dazu, dass die Kommunikation erheblich erschwert wird und Fristen schneller verdrängt werden. Da Gruppenarbeiten und Seminare ein zentraler Bestandteil des Studiums der Geschichtswissenschaften darstellen, stellt sich hier die Frage, wie man Zusammenarbeit zugunsten einer besseren Kommunikation und einen besseren Zusammenhalt optimieren kann. Eine hilfreiche Methodik könnte zum Beispiel in der Nutzung von „Check-In-Fragen“ liegen.
Mit „Check-In-Fragen“ sind Fragen gemeint, die am Anfang jedes Seminars oder Gruppenarbeit als eine Art „Check-In“ dienen und das Ankommen unterstützen. Die Anzahl an möglichen Fragen ist unendlich und kann je nach Seminar fachlich spezifiziert werden. So könnte eine allgemeine „Check-In-Frage“ lauten „Was bringt dich zum Lachen?“ oder auf Gruppenarbeiten bezogen könnte „Was erwartest du von dieser Gruppenarbeit?“ auch eine „Check-In-Frage“ darstellen. Die „Check-In“-Methode kann dazu beitragen, dass die Teilnehmenden gedanklich präsent sind, ein gemeinsames Verständnis gefördert wird, jede*r Teilnehmende zu Wort kommt, das Vertrauen gestärkt wird und man eine persönliche Nähe zu den anderen Studierenden aufbauen kann (Popovic o.J.). Mithilfe von „Check-In-Fragen“-Generatoren wie zum Beispiel www.checkin-generator.de lassen sich ganz leicht und ohne viel Mehraufwand automatisch „Check-In-Fragen“ sowie „Check-Out-Fragen“ generieren. „Check-Out-Fragen“ sind hierbei Fragen, die am Ende jedes Seminars oder Gruppensitzung gestellt werden können. Sie sollten neben „Check-In-Fragen“ auch in Betracht gezogen werden. Mögliche Fragen könnten lauten: „Was nehmen Sie aus der heutigen Sitzung mit?“, „Was hat Sie am meisten überrascht?“ oder „An welcher Aufgabe möchtest du an der nächsten Gruppensitzung weiterarbeiten?“. „Check-Out-Fragen“ können hier ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung zu Gruppenarbeiten und Seminaren bieten, indem sie das Gelernte noch einmal abfragen können sowie die Möglichkeit für ein kurzes Feedback gegeben ist. So können Veränderungen und Entwicklung während des Semesters besser wahrgenommen werden, der Seminarinhalt verbessert werden und ein Anreiz zum nachhaltigeren Mitmachen gegeben werden.

In den Geschichtswissenschaften wäre es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, „Check-In-Fragen“ dem thematischen Inhalt des Seminars anzupassen. In einem Seminar zum Zweiten Weltkrieg könnte eine mögliche „Check-In-Frage“ zum Beispiel lauten: „Haben Sie aus Ihrem familiären Umfeld (Großeltern, Urgroßeltern, etc.) Geschichten oder persönliche Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen?“. An diese „Check-In-Frage“ könnte man dann wieder Inhalte wie „oral history“ oder Gedenkstätten anknüpfen. Auf diese Art und Weise bieten „Check-In-Fragen“ die Möglichkeit den Seminarinhalt um persönliche Bezüge beziehungsweise Anknüpfungspunkte zu erweitern und Studierende haben die Chance anhand eigener Beispiele oder Erzählungen von Kommiliton*innen Themen der Neueren Geschichte zu erarbeiten. Da gerade die Geschichtswissenschaften sehr theorielastig sind und viele Studierende häufig das Interesse verlieren, wären „Check-In-Fragen“ sinnvoll, um die Theorie und die Seminarthematik näher an die Studierenden zu bringen. „Check-In-Fragen“ haben zudem dem Vorteil, dass sie je nach Formulierung relativ schnell zu beantworten sind und nicht viel Seminarzeit dafür aufgewendet werden muss. Dieser Aspekt ist gerade in der Hinsicht von Relevanz, dass die meisten Seminare einen sehr strikten Zeitplan haben und häufig kein großer Spielraum gegeben ist. „Check-In-Fragen“ können darüber hinaus aber auch bei der Bildung von Gruppen für Gruppenarbeitsphasen helfen. Letztes Semester beobachtete ich zum Beispiel in einem meiner Seminare, dass einige Studierende keinen Anschluss an andere Gruppen finden konnten. Sie wurden teilweise ausgegrenzt oder haben sich nicht getraut, selbst Kommiliton*innen anzusprechen. Man könnte solche Situationen vermeiden, indem man zum Beispiel die Frage stellt: „Wie ist deine/Ihre heutige Stimmung?“ und dann zum Beispiel vier unterschiedliche Gemütsgruppen zur Verfügung stellen, zu denen man sich zuordnen kann. Die Menschen in der jeweiligen Gruppe haben dann schon eine gewisse Gemeinsamkeit und es fällt den Gruppenmitgliedern leichter sich einander zu öffnen. Hier könnte man die Frage auch an den geschichtlichen Inhalt anpassen und teilweise direkt in eine Diskussionseinheit überleiten. Eine mögliche Fragestellung könnte hier zum Beispiel lauten: „War die Weimarer Republik von Anfang an zum Scheitern verurteilt?“ und als Antwortgruppen könnte man zunächst eine „Ja“- und eine „Nein“- Gruppe erstellen. Diese könnten sich dann austauschen und im Anschluss ihre Argumente der anderen Gruppe präsentieren. Nach einer solchen Gruppendiskussion wäre es auch eine Option, eine Neuverteilung zu machen, wobei sich die Seminarteilnehmenden erneut einer Gruppe zuordnen können. Dadurch kann ein neuer Diskurs entstehen und das komplizierte Gruppensuchen hätte damit ein Ende. Darüber hinaus können die Studierenden hier zunächst Anschluss an Kommiliton*innen finden, die eine ähnliche Meinung vertreten. Dennoch bietet sich die Möglichkeit, in der offenen Plenumsdiskussion einen Eindruck von der anderen Seite zu bekommen und sich auch überzeugen zu lassen. Auf diese Art und Weise kann eine „Check-In-Frage“ auch komplexer und nachhaltiger in den Unterrichtskontext eingebaut werden.
In den Geschichtswissenschaften wäre es meiner Meinung nach durchaus sinnvoll, „Check-In-Fragen“ dem thematischen Inhalt des Seminars anzupassen. In einem Seminar zum Zweiten Weltkrieg könnte eine mögliche „Check-In-Frage“ zum Beispiel lauten: „Haben Sie aus Ihrem familiären Umfeld (Großeltern, Urgroßeltern, etc.) Geschichten oder persönliche Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg mitbekommen?“. An diese „Check-In-Frage“ könnte man dann wieder Inhalte wie „oral history“ oder Gedenkstätten anknüpfen. Auf diese Art und Weise bieten „Check-In-Fragen“ die Möglichkeit den Seminarinhalt um persönliche Bezüge beziehungsweise Anknüpfungspunkte zu erweitern und Studierende haben die Chance anhand eigener Beispiele oder Erzählungen von Kommiliton*innen Themen der Neueren Geschichte zu erarbeiten. Da gerade die Geschichtswissenschaften sehr theorielastig sind und viele Studierende häufig das Interesse verlieren, wären „Check-In-Fragen“ sinnvoll, um die Theorie und die Seminarthematik näher an die Studierenden zu bringen. „Check-In-Fragen“ haben zudem dem Vorteil, dass sie je nach Formulierung relativ schnell zu beantworten sind und nicht viel Seminarzeit dafür aufgewendet werden muss. Dieser Aspekt ist gerade in der Hinsicht von Relevanz, dass die meisten Seminare einen sehr strikten Zeitplan haben und häufig kein großer Spielraum gegeben ist. „Check-In-Fragen“ können darüber hinaus aber auch bei der Bildung von Gruppen für Gruppenarbeitsphasen helfen. Letztes Semester beobachtete ich zum Beispiel in einem meiner Seminare, dass einige Studierende keinen Anschluss an andere Gruppen finden konnten. Sie wurden teilweise ausgegrenzt oder haben sich nicht getraut, selbst Kommiliton*innen anzusprechen. Man könnte solche Situationen vermeiden, indem man zum Beispiel die Frage stellt: „Wie ist deine/Ihre heutige Stimmung?“ und dann zum Beispiel vier unterschiedliche Gemütsgruppen zur Verfügung stellen, zu denen man sich zuordnen kann. Die Menschen in der jeweiligen Gruppe haben dann schon eine gewisse Gemeinsamkeit und es fällt den Gruppenmitgliedern leichter sich einander zu öffnen. Hier könnte man die Frage auch an den geschichtlichen Inhalt anpassen und teilweise direkt in eine Diskussionseinheit überleiten. Eine mögliche Fragestellung könnte hier zum Beispiel lauten: „War die Weimarer Republik von Anfang an zum Scheitern verurteilt?“ und als Antwortgruppen könnte man zunächst eine „Ja“- und eine „Nein“- Gruppe erstellen. Diese könnten sich dann austauschen und im Anschluss ihre Argumente der anderen Gruppe präsentieren. Nach einer solchen Gruppendiskussion wäre es auch eine Option, eine Neuverteilung zu machen, wobei sich die Seminarteilnehmenden erneut einer Gruppe zuordnen können. Dadurch kann ein neuer Diskurs entstehen und das komplizierte Gruppensuchen hätte damit ein Ende. Darüber hinaus können die Studierenden hier zunächst Anschluss an Kommiliton*innen finden, die eine ähnliche Meinung vertreten. Dennoch bietet sich die Möglichkeit, in der offenen Plenumsdiskussion einen Eindruck von der anderen Seite zu bekommen und sich auch überzeugen zu lassen. Auf diese Art und Weise kann eine „Check-In-Frage“ auch komplexer und nachhaltiger in den Unterrichtskontext eingebaut werden.
DAS VERBUNDPROJEKT
CO3LEARN
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER
GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN
Das Projekt Co3Learn wird gefördert aus Mitteln der Stiftung Innovation in der Hochschullehre.
Projektlaufzeit: 01.08.2021 – 31.12.2025 mit bewilligten Fördermitteln von
4.760.895,51 Euro.
Universitätsplatz 2
38106 Braunschweig
Welfengarten 1
30167 Hannover
Wilhelmsplatz 1 (Aula)
37073 Göttingen

© Copyright Co3Learn, created with Royal Elementor Addons and Elementor